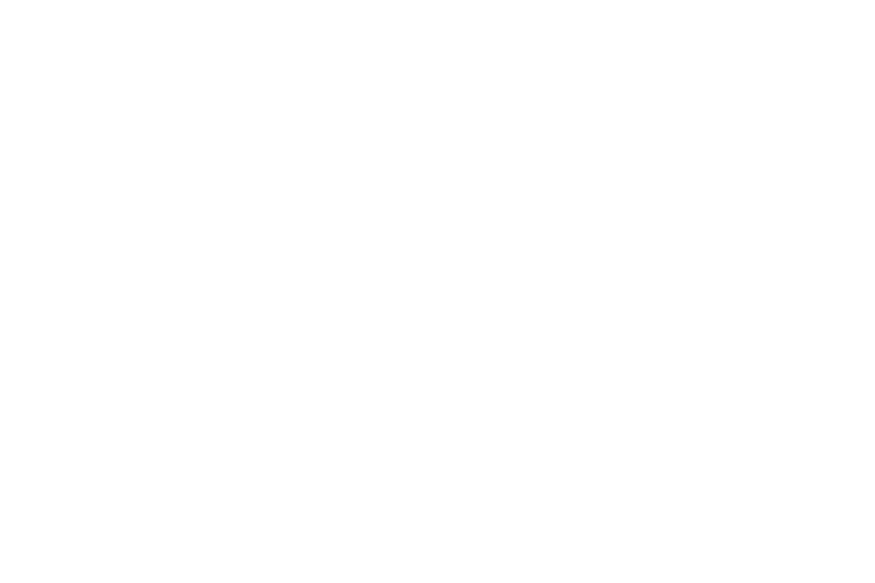Hast du dich schon einmal gefragt, wie große Unternehmen wie Amazon, Autohersteller oder Supermarktketten ihre Bestellungen, Rechnungen und Lieferungen effizient verwalten – ohne endlose E-Mails, Telefonate oder Papierberge? Die Antwort liegt in einer unsichtbaren, aber äußerst leistungsfähigen Technologie: EDI. EDI sorgt dafür, dass Unternehmen Daten blitzschnell und fehlerfrei austauschen können. Ganz ohne menschliches Eingreifen. Doch was genau steckt dahinter? Wie funktioniert EDI, und warum setzen es so viele Firmen ein?
Keine Sorge, du musst kein IT-Experte sein, um das zu verstehen! In diesem Artikel erklären wir dir EDI in einfachen Worten und ohne (zu viel) technisches Fachchinesisch.
Was ist EDI?
EDI steht für Electronic Data Interchange und bezeichnet den elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen Unternehmen, sowohl intern als auch extern. Die Datensätze liegen dabei in der Form von strukturierten Daten basierend auf internationalen EDI-Nachrichtenstandards vor.
EDI wird in verschiedenen Branchen angewendet, unter anderem:
- Logistik: Sendungsverfolgung entlang der Lieferkette, Aufträge an Speditionen
- Handel: Bestellprozesse, Rechnungen, Liefer- und Zahlungsankündigungen
- Automobil: Just-in-Time Lieferungen
- Gesundheitswesen: Patientendaten, Images
- Finanzwesen: Zahlungsanweisungen, sonstige Transaktionen
Was sind die wichtigsten Merkmale von EDI?
EDI hat verschiedene Merkmale, die eine automatisierte Kommunikation zwischen Geschäftspartnern gewährleisten. Ohne menschliches Eingreifen und manuelle Prozesse.
- Standardisierung: EDI verwendet definierte Standards für die Kommunikation und gewährleistet so eine korrekte Datenverarbeitung zwischen verschiedenen Organisationen.
- Automatisierung: Daten müssen nicht mehr manuell übertragen und verarbeitet werden, was die Automatisierung von Geschäftsprozessen und Workflows ermöglicht.
- Effizienz: EDI ermöglicht es, Daten schnell und nahezu in Echtzeit auszutauschen und zu verarbeiten. Dies macht Geschäftsprozesse wesentlich effizienter als die manuelle Verarbeitung.
- Integration: Durch die Standardisierung kann EDI direkt und ohne großen Aufwand an ERP- und andere Systeme angebunden werden.
Wie läuft ein typischer EDI-Prozess ab?
Die Datenübertragung via EDI läuft in vier Schritten ab: Versand, Konvertierung (durch EDI-Software), Übertragung und Empfang von EDI-Nachrichten:
Schritt 1: Erstellung der Geschäftsdokumente.
Der Sender erstellt in seinem System ein EDI-Dokument und versendet es.
Typische EDI-Dokumente sind Bestellungen (ORDERS), Lieferankündigungen (DESADV), Rechnungen (INVOIC) oder Zahlungsankündigungen (REMADV).
Schritt 2: Umwandlung in ein EDI-Format.
Der EDI-Konverter wandelt das Dokument in eines der standardisierten EDI-Formate um, um die übertragenen Daten zu vereinheitlichen und eine korrekte Datenverarbeitung zu gewährleisten.
Gängige Formate sind z.B. EDIFACT, EANCON, SINFOS, SAP IDoc, Fortras, BMEcat, ANSI X12, ODETTE oder ZUGFeRD.
Schritt 3: Übertragung der EDI-Nachricht.
Für die Datenübertragung gibt es zwei verschiedene Methoden:
- Punkt-zu-Punkt-Datenübertragung (Peer-to-Peer): Die direkte Datenübertragung zwischen zwei Endpunkten ohne eine dritte Partei als Vermittler.
- Value-Added Network (VAN): Ein Netzwerk, bei dem eine Drittpartei die Rolle des Vermittlers übernimmt und die Daten überträgt. Dies geschieht normalerweise mit einem Mail-Boxing-Konzept, wobei der Sender die EDI-Nachricht in der zentralen Mailbox des EDI-Dienstleisters bereitstellt. Dort bleibt die Nachricht gespeichert, bis der Empfänger sie abruft.
In der Regel werden für die Datenübertragung verschlüsselte Übertragungsprotokolle verwendet. Typische Protokolle sind SFTP, AS2, SOAP, HTTPS oder OFTP2.
Schritt 4: Empfang und Verarbeitung der EDI-Datei.
Der Empfänger erhält das EDI-Dokument und lässt es durch seinen EDI-Übersetzer automatisiert in das interne Systemformat rückumwandeln. So kann es direkt weiterverarbeitet werden.
5 Vorteile von EDI für Unternehmen.
Der elektronische Austausch von Daten hat viele Vorteile, die nicht nur für große Unternehmen und Konzerne gelten. Auch mittelständische und kleine Unternehmen verschiedenster Branchen profitieren von EDI.
Schnellere Geschäftsprozesse.
Statt Bestellbestätigungen, Rechnungen, Bestands- oder Preislisten, Transportdaten, Lieferscheine, Umsatzsteuermeldungen etc. in Papierform zu verschicken, automatisiert EDI standardisierte Geschäftsprozesse zwischen Unternehmen.
Dies verringert die Bearbeitungszeit wesentlich: Aufträge können beispielsweise innerhalb von Minuten statt Tagen empfangen, weiterverarbeitet und ausgeliefert werden. Dies verbessert auch das Kundenerlebnis erheblich.
Reduzierung von Fehlern.
Fehler durch händische Eingaben können größtenteils vermieden werden. Dies gilt für Zahlendreher in der Mengenangabe ebenso wie fehlerhafte Artikelnummern, die zu Lieferungen falscher Artikel führen.
Einsparung von Kosten.
Mithilfe der elektronischen Datenübertragung können Kosten in den verschiedensten Bereichen gespart werden. So fallen zum einen Kosten für Papier, Porto und Verpackung weg.
Zum anderen werden Personalkosten reduziert, da Routineaufgaben automatisiert erledigt werden und Mitarbeitende ihre Zeit für andere Aufgaben im Tagesgeschäft nutzen können. Auch Lagerkosten reduzieren sich, da Echtzeitdaten eine effizientere Bestandsverwaltung ermöglichen.
Mehr Datensicherheit.
Durch verschlüsselte Datenübertragung und Authentifizierungsmechanismen können Dokumente wesentlich sicherer versendet und bearbeitet werden. Zudem ermöglicht die elektronische Form eine sichere Speicherung sowie ein vereinfachtes Monitoring und Reporting, was besonders für Compliance-Audits von Belang ist.
Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen.
Es mag nur eine kleine Schraube im Getriebe sein, doch EDI erleichtert es Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Durch digitale Prozesse entfällt der Papierverbrauch. Zudem müssen Dokumente nicht per Post verschickt werden, was einen reduzierten Transportbedarf und damit den Wegfall von CO₂-Emissionen bedeutet.
Wie wird EDI implementiert?
Damit Geschäftspartner unabhängig von ihrer intern verwendeten Software (ERP, WWS, AES, SAP etc.) ihre digitalen Daten vollständig integrieren und reibungslos austauschen können, müssen sie sich im Vorfeld auf einen gemeinsamen EDI-Standard einigen.
Europäische Unternehmen verwenden hierfür meist das Standardformat EDIFACT, wobei auch viele andere EDI Standards verwendet werden können.
Verlassen unternehmensspezifische Formate, z.B. CSV-Dateien oder Texte im sog. Feste-Länge-Format (Fixed Length Record) interne IT-Systeme, werden sie von einer EDI-Software konvertiert und mit entsprechenden Kommunikationsprotokollen an den Empfänger übertragen.
Ganz konkret: Versendet ein Geschäftspartner bspw. eine Bestellung als EDI-Nachricht per Mail, nimmt sich die über eine Programmierschnittstelle (API) angebundene EDI-Software (auch: Middleware, EDI-Konverter, EDI-Übersetzer oder EDI-System genannt) den Anhang mit der Bestellung heraus. Anhand von Dateinamen und Betreff identifiziert sie den Vorgang, konvertiert die EDI-Nachricht in das Format des Lieferanten und speist es in dessen ERP-System ein.
Ist die Bestellung lieferantenseitig von allen Abteilungen bearbeitet worden, läuft der externe Prozess diesmal als Auftragsbestätigung in umgekehrter Richtung ab. Alles zeitnah und elektronisch, ohne manuelle Eingaben.
Andere EDI-fähige Geschäftsprozesse sind zum Beispiel die E-Rechnungsstellung, das Supply Chain Management (SCM) oder der Austausch von Dokumenten mit Steuer- und Zollbehörden auch im Ausland.
Was du bei der Implementierung von EDI berücksichtigen solltest.
Zur möglichst schnellen und sicheren Vernetzung mit Geschäftspartnern ist der Einsatz einer Middleware sinnvoll – je nach EDI-Dienstleister als On-Premises Installation oder in der Cloud als Managed Service gehostet.
Der Vorteil dieser EDI-Tools ist, dass sie bereits alle Funktionalitäten für die EDI-Konvertierung und -Kommunikation enthalten und Unternehmen so aufwändiges Programmieren erspart wird. Ist die gewählte EDI-Lösung zudem No-Code-basiert, können Business-Verantwortliche selbstständig spezifische Prozesse konfigurieren, elektronisch aufsetzen und damit die IT entlasten.
Vor dem eigentlichen Release müssen sich EDI-Partner auf die Anzahl und Art ihrer Nachrichten, das unterstützte Kommunikationsprotokoll sowie den Nachrichtenstandard (z.B. EDIFACT) einigen.
In einem zweiten Schritt ist – unter Umständen mithilfe des EDI-Providers – eine auch als „ERP-Konnektor“ bezeichnete Schnittstelle (Datenbanktabelle, Textdatei) als Datenquelle und -ziel einzurichten. Es sei denn, das im Unternehmen eingesetzte WWS oder ERP-System enthält diese bereits standardmäßig.
Nach erfolgreicher Testphase mit Prüfung möglichst zahlreicher EDI-Prozesse kann schließlich auf die Produktivinstanz umgestellt und der elektronische Datenaustausch in den Unternehmensalltag integriert werden.
Lobsters Data Platform: Die passende EDI-Software für jeden Anwendungsfall.
Zur einfachen und schnellen Umsetzung von EDI-Projekten in jeder erdenklichen Branche haben wir unsere hauseigene EDI-Lösung, die Lobster Data Platform, entwickelt.
Als Middleware übernimmt sie beim Electronic Data Interchange eine Art Vermittlerfunktion und sorgt für den nahtlosen und sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen, indem sie deren EDI-Formate automatisiert übersetzt.
Unsere EDI-Plattform unterstützt die Verarbeitung aller gängigen EDI-Standards, verfügt über eine automatische Formaterkennung und stellt dir über 4.000 EDI-Vorlagen zur Verfügung. Und das über zahlreiche sichere Übertragungsprotokolle.
Du willst mehr als nur EDI als Punkt-zu-Punkt-Datenübertragung? Auch da haben wir etwas für dich! Mit der Anbindung an unser Data Network wird dein Unternehmen Teil eines digitalen Ökosystems, das den Datenaustausch revolutioniert. Tausche direkt Daten mit Kunden und Behörden aus, die bereits selbst Teil des Netzwerks sind. Oder lade deine Kunden und Partner ein, ebenso mitzumachen, um so euren elektronischen Datenaustausch auf das nächste Level zu heben. Nicht Point-to-Point, sondern 1-to-n.