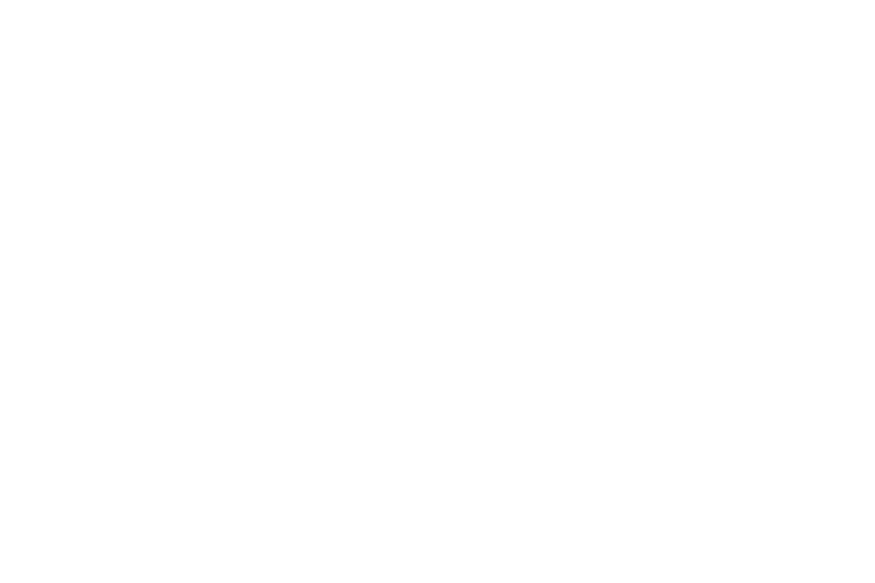Das Jahr 2025 hat begonnen und damit auch die Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung in Deutschland. Doch keine Panik. Entgegen so mancher irreführender Werbung für bestimmte E-Rechnungssoftware bedeutet das nicht, dass du die Verpflichtung zur E-Rechnung bereits ab Januar vollständig umgesetzt haben musst. Im Gegenteil.
Was sich im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung (auch E-Invoicing genannt) wann für wen ändert und warum, das erfährst du in unseren Fragen und Antworten zur Einführung.
Was ist eine E-Rechnung?
Im deutschen Recht galt als E-Rechnung bislang jede Rechnung, die elektronisch übermittelt wurde. Dies ist jedoch seit dem 1. Januar 2025 nicht mehr der Fall. Nun müssen E-Rechnungen auch maschinell lesbar sein.
Einfache PDF-Rechnungen oder ähnliche Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form gelten als sonstige Rechnung und werden nicht mehr als elektronische Rechnung anerkannt. Sie verlieren zudem, ebenso wie Rechnungen auf Papier, in naher Zukunft ihre umsatzsteuerrechtliche Gültigkeit als ordnungsgemäße Rechnung.
Wer ist zur elektronischen Rechnung verpflichtet?
Im Rechnungsverkehr zwischen Unternehmen und deutschen Behörden (B2G) ist die E-Rechnung schon seit 2020 Pflicht. Ab 2025 wird die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung nach und nach auch für deutsche Unternehmen untereinander (B2B) eingeführt.
Ab wann ist die Einführung der E-Rechnung Pflicht?
Die Pflicht zur Einführung der obligatorischen E-Rechnung kommt in Etappen:
- Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle Unternehmen in Deutschland in der Lage sein, E-Rechnungen von anderen inländischen Unternehmen zu empfangen.
- Ab dem 1. Januar 2027 müssen deutsche Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 800.000 Euro ihre Rechnungen selbst als E-Rechnungen erstellen und versenden. Kleinunternehmer sind damit noch ein weiteres Jahr von dieser Regelung ausgenommen.
- Ab dem 1. Januar 2028 sind dann alle Unternehmen, unabhängig vom Jahresumsatz, zur elektronischen Rechnungsstellung im B2B-Geschäft verpflichtet.
Was passiert, wenn Unternehmen die Stichtage verpassen?
Unternehmen, die die Pflicht zur Ausstellung der E-Rechnung zum 1. des jeweiligen Jahres nicht rechtzeitig umsetzen, müssen zum einen mit Sanktionen und Bußgeldern rechnen. Zum anderen werden auch Zahlungsverzögerungen sowie die Ablehnung gestellter Rechnungen auf sie zukommen.
Warum werden E-Rechnungen Pflicht?
Die Einführung der obligatorischen E-Rechnung für Unternehmen geht im Wesentlichen auf die EU-Initiative ViDA (VAT in the Digital Age) zurück. Deren Ziel ist es, das Umsatzsteuersystem innerhalb der EU zu vereinheitlichen, Steuerkontrollen zu erleichtern und so Steuerbetrug und Verwaltungsaufwand zu minimieren. Die E-Rechnung im B2B-Rechnungsverkehr wird daher auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU verpflichtend. Frankreich und Spanien etwa planen mit einer Einführung ab Mitte 2025, Belgien will Unternehmen untereinander ab Anfang 2026 zur elektronischen Rechnungsstellung verpflichten.
Exkurs: Wie steht es mit der Verpflichtung zur E-Rechnung in Österreich und der Schweiz?
Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich gibt es bereits Pflichten zur elektronischen Rechnungsstellung an Behörden. Im B2B-Geschäft ist die elektronische Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern in beiden Ländern bis auf Weiteres freiwillig.
Welche technischen Anforderungen an eine elektronische Rechnung gibt es?
Laut aktuellem Entwurf zur Neuregelung der E-Rechnung durch das Wachstumschancengesetz ist sie eine Rechnung, die „in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht“.
Es gibt bereits Formate, die für die E-Rechnung zulässig sind. Diese sind nach der Richtlinie 2014/55/EU bzw. EN 16931 genormt und kommen schon bei der Rechnungsstellung zwischen Unternehmen und Behörden zum Einsatz. Dazu gehören in Deutschland XRechnung (reine XML-Datei in der Syntax CII oder UBL) und ZUGFeRD ab Version 2.0.1 (Hybrid aus PDF/A-3 und XML).
Beim Empfang einer elektronischen Rechnung zwischen Unternehmen dürfen vorerst auch andere Formate wie EDIFACT zum Einsatz kommen. Dies gilt jedoch nur, solange alle wichtigen Rechnungsdaten maschinell in ein genormtes Format überführt werden können. Auch ausländische Formate, die der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung entsprechen, kommen in Betracht – darunter etwa FatturaPA (Italien), Factur-X (Frankreich) und FacturaE (Spanien).
Exkurs: Wo liegt der Unterschied zwischen E-Rechnung und XRechnung?
Der Begriff „E-Rechnung“ umfasst alle elektronischen Rechnungen, ganz gleich in welchem Format. Unter XRechnung versteht man hingegen ein konkretes E-Rechnungsformat. Dieses basiert auf einer XML-Datei (daher auch das X in XRechnung).
Anders formuliert: Wer eine E-Rechnung empfangen oder versenden will, kann dafür die XRechnung nutzen. Er kann aber auch auf ein anderes Format wie z. B. ZUGFeRD zurückgreifen.
Was muss eine E-Rechnung enthalten?
Eine E-Rechnung muss, wie jede andere Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format, alle wichtigen Pflichtangaben enthalten, die in § 14 Absatz 4 UstG geregelt sind. Der Umfang einer E-Rechnung ergibt sich daher wie folgt:
- Name und Anschrift des Rechnungsstellers
- Name und Anschrift des Rechnungsempfängers
- Steuernummer und/oder Steuer-ID des Rechnungsstellers
- Ausstellungsdatum
- Rechnungsnummer
- Menge und Art der Liefergegenstände oder erbrachten Dienstleistungen
- Zeitpunkt der Lieferung oder erbrachten Dienstleistung
- Entgelte mit Ausweis der Steuern
- Steuersatz und Steuerbetrag, alternativ Hinweis zur Steuerbefreiung
- ggf. einen Hinweis zur Aufbewahrungspflicht des Rechnungsempfängers
- falls zutreffend: die Angabe „Gutschrift“
Wie kann eine E-Rechnung übermittelt werden?
Für die Übermittlung einer E-Rechnung gibt es verschiedene Übertragungskanäle. Neben E-Mail und Web-Upload können Unternehmen auch über eigene Portale sowie über das PEPPOL-Netzwerk elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten. Spezialisierte Software zur Datenintegration ermöglicht es, die eingegangenen Rechnungsdaten zur weiteren Verarbeitung automatisiert in bestehende Systeme zu überführen.
PEPPOL, XRechnung, ZUGFeRD, XML, PDF/A-3: Wer sich das erste Mal mit E-Invoicing beschäftigt, stößt auf allerlei neue Begriffe. Die wichtigsten davon erklären wir kurz und knapp in unserem E-Invoicing Glossar.
Wie wird eine elektronische Rechnung ausgestellt?
Für das Versenden und die Ausstellung einer E-Rechnung benötigen Unternehmen in der Regel eine entsprechende Software. Das kann die Buchhaltungssoftware, das ERP-System oder auch eine Datenintegrationsplattform wie Lobster sein. Letztere greift auf Daten aus bestehenden Systemen zu, überführt diese in ein zulässiges E-Rechnungsformat und versendet die daraus generierten E-Rechnungen via Schnittstelle an den Rechnungsempfänger.
Mit Lobster die verpflichtende E-Rechnung schnell und einfach umsetzen.
XRechnung. ZUGFeRD. Factur-X. FacturaE. Mit Lobster kannst du elektronische Rechnungen in allen relevanten Formaten erstellen und über alle wichtigen Kanäle empfangen und versenden – nicht nur in Deutschland, sondern international.
Unser Data Product Invoicing ermöglicht es Lieferanten und Geschäftspartnern, E-Rechnungen eigenständig einzureichen und automatisiert zu prüfen. Und dank Anbindung an wichtige E-Invoicing Netzwerke und Clearingsysteme kommen deine eigenen Rechnungen zuverlässig bei Geschäftskunden und Behörden an – wir bieten sogar selbst einen PEPPOL Access Point, damit du deine E-Rechnungsdaten noch einfacher an Behörden übermitteln kannst!

Trotz gewissenhafter Recherche können wir Fehler nie ganz ausschließen. Ihnen fehlt eine Information oder Sie haben einen Fehler entdeckt? Dann melden Sie sich bei uns unter [email protected].