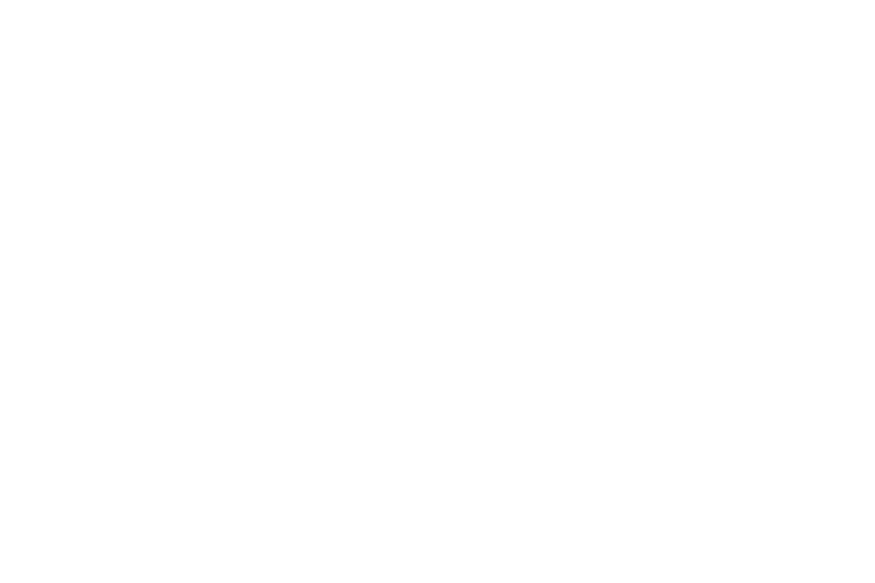Digitale Plattformen sind überall – ob beim Online-Shopping, Streaming oder für Banküberweisungen. Mittlerweile denken wir als Nutzer gar nicht mehr darüber nach. Waren mittels Papierkatalog und Telefon bestellen? DVDs in der Videothek ausleihen? Überweisungsformulare ausfüllen und in den Briefkasten der Bank einwerfen? Relikte aus alten Zeiten (ja, 20 Jahre gehen schnell vorbei)…
Aber was genau steckt hinter diesen Platforms? Wie funktionieren sie? Warum sind gerade auch für Unternehmen digitale Plattformen unverzichtbar? Hier bekommst du die Antworten. Einfach zusammengefasst und inklusive Praxisbeispielen.
Was ist eine digitale Plattform?
Unterstützt durch Künstliche Intelligenz (KI) und praktisches Informatik-Know-How vernetzen Digital Platforms Prozesse, Anwendungen, Daten, Dienste und Nutzer zu einem Wertschöpfungs-Netzwerk: einem sogenannten digitalen Ökosystem.
Plattformen bieten Verbrauchern und Unternehmen, Anbietern und Abnehmern Zugang zu einer umfassenden Auswahl an digitalen Produkten und Dienstleistungen innerhalb eines Marktes oder über mehrere Märkte hinweg. Die Vernetzung selbst wird häufig durch eine zentrale Infrastruktur realisiert, über die die verschiedenen Akteure miteinander interagieren, Daten austauschen und Transaktionen durchführen können.
Typen digitaler Plattformen.
Es gibt verschiedene Arten von Onlineplattformen – je nach Schwerpunktsetzung. Durch ihre zunehmende Vernetzung können sie auch verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. Hier ein Auswahl:
Transaktionsplattformen.
- E-Commerce-Plattformen bzw. Online-Marktplätze wie Amazon und ebay bedienen Angebot und Nachfrage und ermöglichen den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen.
- Transport- und Mobilitätsplattformen wie Uber oder BlaBlaCar vermitteln Fahrdienstleistungen zwischen Fahrern, Fahrgästen und Fahrzeugnutzern.
- Content- und Medienplattformen wie Netflix, YouTube oder Spotify bieten digitale Inhalte wie Filme, eBooks, Fotos und Videos, Musik oder Podcasts an.
- Finanz- und Zahlungsplattformen wie PayPal, Trade Republic oder Klarna helfen, Online-Zahlungen, Banktransaktionen oder Börsengeschäfte durchzuführen.
- Gesundheitsplattformen wie DoctoLib und Jameda ermöglichen die Vermittlung von Arztterminen, die Durchführung medizinischer Beratungen online oder das Angebot von Sport- und Fitnessprogrammen.
Datenzentrierte Plattformen.
- Soziale Netzwerke und Communitys wie Instagram, Reddit oder LinkedIn lassen Nutzer Informationen austauschen, soziale Interaktionen durchführen und sich in speziellen Fachgruppen zusammenfinden.
- Kollaborationsplattformen wie Microsoft Teams oder Jira ermöglichen die online-basierte Zusammenarbeit in Gruppen z.B. mittels Videokonferenz, Dateiaustausch und Ticketsystem für das Projektmanagement.
Integrationsplattformen.
- Smart-Home- und IoT-Plattformen wie Ring oder Amazon Alexa verbinden intelligente Geräte und machen sie aus der Ferne steuerbar, beispielsweise per Handy-App.
- Software- und Cloud-Plattformen bieten Dienstleistungen wie Software (SaaS), Infrastruktur (IaaS) oder die Entwicklungs- und Integrationsplattform selbst (iPaaS) an – meist in der Cloud. Typische Beispiele sind Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Lobster.
Wie funktioniert eine Digital Platform?
Vom Aufbau von Plattformen im Rahmen der digitalen Transformation profitieren vor allem jene Branchen, die auf hohe Konnektivität angewiesen sind, wie beispielsweise Handel und Logistik. Dabei liegen erfolgreichen Plattformen gewisse Prinzipien zugrunde.
Trennung von Technologie- und Benutzer-Ebene.
Grundlegende Idee beim Aufbau einer digitalen Plattform ist die Abstraktion von technischer bzw. technologischer Infrastruktur und Funktionalität sowie fachlicher Benutzerebene.
Auf diese Weise können auch Nutzer und Anbieter ohne IT-Kenntnisse die auf einer Plattform angebotenen Dienstleistungen nutzen und sich miteinander vernetzen. Technisches Know-How benötigen lediglich die Plattform-Betreiber, die die Plattform entwickeln, bereitstellen, warten und zu Geld machen.
Stabile und performante Infrastruktur.
Der zuverlässige Betrieb digitaler Plattformen erfordert den Rückgriff auf eine robuste Hardware-Infrastruktur in einem modernen Rechenzentrum sowie ein leistungsfähiges Software-System zur parallelen Abwicklung zahlreicher Transaktionen.
Hinzu kommt ein zweites System, um effizient Schnittstellen (APIs) aufzubauen, über die Hardware, Anwendungen, Services und Benutzer verknüpft werden. Für die Speicherung und den Abruf von Daten wird schließlich eine sichere, leistungsstarke, geclusterte Datenbank benötigt.
Je häufiger manuelle Eingaben auf der Plattform stattfinden, desto wichtiger ist eine benutzerfreundliche und skalierbare Bedienoberfläche. Diese wird meist als Web-Applikation mit Graphical User Interface (GUI) gestaltet.
Ein Beispiel aus der Praxis.
Am Use Case einer Logistik-Plattform lässt sich der Nutzen digitaler Integrationsplattformen schnell verdeutlichen.
Binden sich Spediteure an dieselbe Plattform wie verladende Unternehmen an, kann prinzipiell jeder angebundene Verlader jeden angebundenen Spediteur über die Plattform beauftragen und vom Spediteur über den Status seines Auftrags informiert werden.
Im Idealfall laufen die Informationen direkt vom IT-System des einen Partners in das IT-System des anderen Partners.
Bilateral statt vernetzt? 6 Pain Points ohne Plattform.
Hohe Kosten. Geringe Reichweite. Wenig Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. Ineffiziente Geschäftsprozesse. Sind digitale Transformation und Industrie 4.0 das Ziel, stellen zahlreiche bilaterale Verbindungen – also nur für einen bestimmten Zweck nutzbare Verbindungen zwischen zwei Endpunkten – einen absoluten Nachteil dar. Welche, das erfährst du im Folgenden.
1. Höhere Kosten.
Ohne Online-Plattform häufen sich nicht nur Vertriebs-, sondern auch Marketing- und personelle Kosten.
Statt Zahlungstransaktionen, Logistikdienstleistungen oder Marketingaktivitäten online abzuwickeln, heißt es, Rechnungen per Post zu verschicken, Termine telefonisch abzustimmen und traditionelles Marketing via Printmedien und TV zu betreiben. Das ist nicht nur zeitaufwändig und mühsam, sondern auch teuer.
2. Unzureichende Skalierbarkeit.
Wer keine Integrationsplattform nutzt, die Prozesse automatisiert und deren schnittstellenbasierte Architektur eine leichte Anpassung an sich ändernde Geschäftsbedingungen ermöglicht, gerät schnell ins Hintertreffen.
Kunden und Partner müssen manuell gewonnen werden und ihre Anbindung an das eigene Netzwerk ist zeit- und kostenintensiv. Auch neue Workflows und Prozesse müssen händisch aufgesetzt werden und sorgen häufig für Unterbrechungen des täglichen Geschäfts.
3. Mangelnde Transparenz.
Ob digitales Ökosystem oder klassische Zusammenarbeit zwischen Unternehmen: Geschäftsmodelle binden eine Vielzahl unterschiedlicher Partner.
Weiß der KFZ-Hersteller allerdings nicht, ob der Zulieferer noch genügend A-Teile vorhält oder ob beim Spediteur auch kurzfristig genügend Fahrer verfügbar sind, kommen Abläufe ins Stocken. Kunden können nicht bedient werden, da unternehmensübergreifend keine Daten-Transparenz gegeben ist.
4. Weniger Reichweite.
Der Zugang zu globalen Märkten ist ohne Online-Plattformen sehr begrenzt. Unternehmen können keine Netzwerkeffekte nutzen und sind hauptsächlich auf lokale Kunden angewiesen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit verringert.
Gerade im Einzelhandel kann ein Online-Shop für internationale Kunden im Vergleich zum traditionellen Ladengeschäft mit regionalen Kooperationen einen großen Unterschied machen.
5. Schlechteres Kundenerlebnis.
Ohne ausreichende Automatisierung verbringen Kunden unnötig viel Zeit in Warteschleifen am Telefon, obwohl sie beispielsweise nur schnell den Status ihrer Anfrage oder ihres Auftrags einsehen wollen.
Zudem erwarten Kunden oft personalisierte Erlebnisse und auf sie zugeschnittene Angebote. Diese sind jedoch ohne die automatisierte Analyse von Daten und Kundenverhalten, auch KI-gestützt, kaum zu generieren.
6. Fehlende Wettbewerbsfähigkeit.
Märkte entwickeln sich mitunter erratisch, vor unangenehmen Überraschungen ist kein Geschäftsmodell geschützt. Sinkende Umsatzzahlen durch technologische Innovationen anderer? Verstärkter Wettbewerb durch disruptive Player? Plötzliche Umkehr im Konsumentenverhalten durch äußere Ereignisse?
Ohne Plattformen fehlen in der Regel wichtige Statistiken zur Marktentwicklung und damit die Basis für marktorientierte Entscheidungen. Wer also keine Plattform nutzt, verliert schnell Kunden und Marktanteile and die smartere Konkurrenz.
Wirtschaftliche Vorteile durch digitale Plattformen.
Aus den zuvor beschriebenen Nachteilen ergeben sich im Umkehrschluss natürlich diverse Vorteile, die Digital Platforms gegenüber bilateralen Verbindungen haben. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze:
- Einfache Skalierbarkeit und damit deutliche Kostensenkung durch die Mehrfachnutzung digitaler Schnittstellen und die Möglichkeit für eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern, gleichzeitig zu agieren
- Bessere Zusammenarbeit aller Akteure durch größere globale Reichweite, wodurch Unternehmen leichter Angebote platzieren, Dienstleistungen anbieten und neue Kunden gewinnen können, um so mehr Einnahmen zu generieren
- Mehr Wertschöpfung mit signifikantem finanziellem Mehrwert durch gebündelte, automatisierte Abläufe, beschleunigte Abwicklung und gesteigerte Kundenzufriedenheit
- Mehr Transparenz und damit deutlich mehr Wettbewerbsfähigkeit durch die zeitnahe Verfügbarkeit geschäftsrelevanter Informationen und die koordinierte Steuerung aller Prozesse
- Schnellere Reaktion bei sich verändernden Marktbedingungen durch statistische Auswertungen der Daten, die Plattformen sammeln
Lobsters Data Platform: Datenintegration und Prozessautomatisierung auf Knopfdruck.
Unsere hauseigene Daten-Plattform bietet alle Vorteile und jeden Mehrwert, den du für die Online-Strategie deines Unternehmens benötigst.
Lobster arbeitet mit allen gängigen Formaten, Systemen und Anwendungen für höchste Konnektivität. Als Plattformlösung verknüpft unsere Software interne Systeme (EAI), externe Systeme (EDI) und Cloud-Systeme.
Integriere verschiedene Systeme mittels vorgefertigter Konnektoren. Oder baue eigene Self-Service-Portale beispielsweise für die Datenerfassung oder zur Auswertung und Überwachung aller auf der Plattform laufenden Transaktionen. Ganz ohne Programmieraufwand.
Entwickle und baue deine eigenen APIs. Entweder selbstständig, mit Hilfe eines Lobster Partners, oder als buchbarer Service durch Lobster Consultants. Sie bestimmen.Der Betrieb der Plattform von Lobster ist in jedem modernen Rechenzentrum möglich. Wir vermitteln auf Wunsch einen Anbieter, sorgen für die redundante, lastverteilende Installation (High Availability, Load-Balancing) und bieten ein 24/7-Monitoring. Oder du nutzt unsere Data Platform in der Cloud – gehostet und gewartet durch Lobster.